Studieren, Promovieren und Habilitieren – in Einsamkeit und Freiheit?
Humboldt war der Ansicht, es forsche sich am Besten in Einsamkeit und Freiheit. Wiewohl ich Humboldt in vielerlei Recht gebe und vor allem seine Forderung nach Freiheit in drittmittelfinanzierten Universitäts-Zeiten wieder enorm an Aktualität gewonnen hat, muss ich ihm doch in seinem Ansinnen nach Einsamkeit zumindest teilweise widersprechen.
Gegen Humboldts Konzept der Selbstbildung, das sich gegen ein Wissen richtet, welches allein einer praxisorientierten Berufsausbildung dient, ist m.E. nichts einzuwenden. Auch wenn der fleißige Student sich einsam seinen Büchern widmet, ist daran noch nichts Schlechtes zu erkennen. Für die Mehrheit der modernen Wissenschaftler ist dies wohl dennoch ein überholtes Konzept. Ich halte viel von Universitäten als wissenschaftlichen Lern- und Lebensräumen. Natürlich können die meisten Vorlesungen nachgelesen, als Podcast heruntergeladen werden oder Seminare als knappe, verschriftlichte Zusammenfassungen womöglich wesentlich schneller den Weg in die Köpfe der Studierenden finden. An die Uni muss der moderne Student nur noch selten – allerdings bleibt bei diesem Konzept des Wissenserwerbs dennoch etwas auf der Strecke: der akademische Geist und kollegiale Austausch, der wissenschaftliches Denken trotz aller Hindernisse, Mühungen und Unzulänglichkeiten so attraktiv werden lässt und persönliche Bildungsprozesse befördert.
Ich bin froh, dass es an der Universität Fribourg Grundsatzgespräche zwischen Bürotür und –angel und Diskussionen bei mal besserem und mal schlechterem Mensaessen gibt und ich vermute, dass sie entscheidend die Qualität wissenschaftlicher Arbeit beeinflussen – zumindest aber die Motivation. Selbst Kant, der zeitweise sehr einsam forschte, hat immer wieder Wissenschaftler und Reisende aus aller Welt zum Disput an seinen Tisch versammelt.
Um erfolgreich eine wissenschaftliche Laufbahn zu meistern gehört, wie Bourdieu schon in den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts festgestellt hat, nicht nur akademisches Wissen, sondern vor allem auch die Beherrschung der sozialen Codes. Diese lernt man in keinem Lehrbuch, sondern nur, in dem man die Spielregeln selbst spielt (siehe auch die Faustregeln von Andreas Wimmel in diesem Blog). Dieses soziale „Spiel“ findet nicht theoretisch, sondern jeden Tag aufs Neue in Universitätsgebäuden und Forschungseinrichtungen statt und insbesondere externe Doktoranden sind gut beraten, sich Netzwerke zu suchen („Nachwuchs, ins Netzwerk statt in die Eremitage!“), in denen diese Spielregeln thematisiert werden. Die sozialen „Regeln“ des Wissenschaftssystems immer wieder kritisch zu hinterfragen und willig zu sein, diese auch aus guten Gründen bewusst abzulehnen oder zu ändern, ist m.E. eine Pflicht jedes Nachwuchswissenschaftlers. Das geht aber nicht einsam vom heimischen Schreibtisch aus, sondern nur indem man Wissenschaft täglich als kritische Auseinandersetzung begreift und sie auch so lebt.
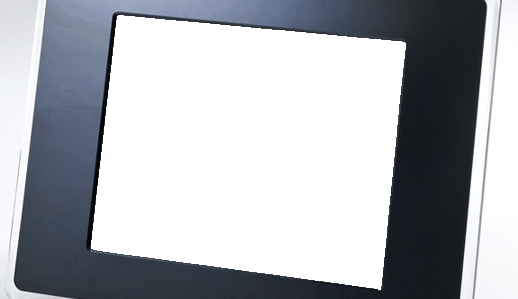

23. April 2009 um 09:20
An sich kann ich Frau Reinwand nur zustimmen, wenn sie Wissenschaft als lebendigen Diskurs mit anderen Leuten sieht.
Was mir aber nicht so ganz gefällt: es bleibt den Studenten des neuen Bachelor-/Mastersystems in vielen Fällen gar keine andere Möglichkeit, als ihr Wissen in der Universität in Veranstaltungen zu erwerben. Aufgrund von Anwesenheitspflicht muss man sich zwingend Seminare und auch Vorlesungen antun, die man sich vielleicht wesentlich besser aus schriftlichen Unterlagen oder in einer Lerngruppe hätte erarbeiten können. Der „akademische Geist und kollegiale Austausch“ – in Freiheit – mag zwar während der Promotion noch vorhanden und möglich sein, aber durch eine zunehmende Verschulung des Systems wird die Freiheit des Studierenden, die für Reflektion und Innovation meiner Meinung nach notwendig ist, immer stärker beschnitten.
Ich habe selbst ein B.Sc./M.Sc.-Studium abgeschlossen, in dem aber ein verhältnismäßig großer Anteil an frei wählbaren Kursen und Vertiefungsfächern möglich war. Da der Studiengang akkreditiert werden musste, wurden aber in den letzten Jahren die Wahlmöglichkeiten auf ein Minimum beschränkt. Sogar „Soft Skills“ ist jetzt etwas, was man an der Universität vorgeschriebenerweise in einem Kurs lernen muss – und nicht „in dem man die Spielregeln selbst spielt“.
27. April 2009 um 23:32
“Soft Skills” als Pflichtkurs an der Universität. So etwas wäre vor 10 Jahren noch undenkbar gewesen in einem Universitätsstudiengang, zumal es dafür ja auch entsprechende und m.E. bessere Kurse beim Arbeitsamt gibt. Nun ist in letzterer Einrichtung seit einigen Jahren auch vieles an Geldern gestrichen worden (der Senkung des Beitrags zur Arbeitslosenversicherung sei Dank!), aber muß so etwas die Universität leisten? „Soft Skills“ ist eine Begrifflichkeit für eine Kategorie von sozialen Fähigkeiten, die vor allem von Arbeitgebern der privaten Wirtschaft gewünscht wird, weniger im Wissenschaftsbetrieb, zumindestens in der von der Privatwirtschaft nachgefragten Form. Die Regeln des Wissenschaftsbetriebes lernt immer noch am besten durch Mitmachen und Mitdiskutieren, wozu man ja als Student ausreichend Gelegenheit hat (oder haben sollte!). Überraschen kann einen heute wohl nichts mehr in den „bolognisierten“ Studiengängen, da kann man nur warten bis die ersten Prüfungsordnungen mit vorgeschriebenen 1-semestrigen Bewerbungsseminaren auftauchen….