Vom Sinn und Unsinn wissenschaftlicher Kongresse
Unbestritten gehören Tagungen und Kongresse, vor allem wenn sie internatonaler Natur sind, zu den angenehmen Seiten eines Wissenschaftlerlebens. Man lernt andere (Wissenschafts-) Kulturen und Universitäten kennen, tauscht sich aus und trifft sich wieder (sog. Networking), bekommt diese oder jene mehr oder weniger berühmte Wissenschaftlerpersönlichkeit zu Gesicht und ist angeregt und motiviert über seinen eigenen Schreibtisch hinauszusehen. Logisch – wissenschaftliche Konferenzen haben ihren Sinn! Seit ich aktuell aber von einem grossen internationalen, wissenschaftlichen Kongress zurück bin, lässt mich die Überzeugung nicht los: auch ihren Unsinn!
So liefen an besagtem Kongress teilweise 40 sessions mit jeweils drei viertelstündigen Beiträgen parallel und die Themen waren – dem SEHR allgemeinen Konferenzthema geschuldet – inhaltlich kaum zusammenhängend organisiert. Themen, Forschungsdisziplinen und Methoden in Buffetthäppchen leicht verdaulich aufbereitet… aber Achtung! – von zu viel geistiger Nahrung durcheinander konsumiert bekommt man leicht Magenverstimmung.
Der Sinn über fast eine Woche lang Themen anzureissen, ohne sie inhaltlich zu einer Synthese zu verbinden oder bewusst einander gegenüberzustellen, erschliesst sich mir nur partiell. Zurück bleibt ein Wust von Eindrücken eines postmodernen „anything goes“, was wohl selten in eine wissenschaftliche Horizonterweiterung mündet, da vor dem inneren Auge alles verschwimmt und unpräzise bleibt. Zurück bleibt das Gefühl, vieles gehört und wenig gelernt zu haben. Sicherlich sieht dies jedoch bei kleineren Konferenzen, die bereichs- und themenspezifischer ausgerichtet sind ganz anders aus und ist vielleicht auch nicht für alle gross angelegten Kongresse in gleichem Masse gültig.
Was jedoch zur Oberflächlichkeit eines solch grossen Kongresses m.E. zusätzlich beiträgt, ist die Sprache. Gezwungenermassen wird auf Englisch präsentiert, was gerade in den Geisteswissenschaften nicht immer und für alle ein leichtes Unterfangen darstellt. Das Niveau der Vortragenden und Zuhörer (vom native speaker bis zum Schulenglisch) variiert stark und oft werden wesentliche Aspekte einer Präsentation durch Sprachbarrieren verzerrt. Fragen können nur ungenügend beantwortet werden oder werden aufgrund von sprachlicher Unsicherheit gar nicht erst gestellt und inhaltliche Mängel des Vortrages durch unzureichende Sprachkenntnisse entschuldigt. Natürlich traut sich kaum jemand, diesen Sachverhalt öffentlich zu kritisieren – man setzt sich ja dem Verdacht aus, vielleicht selbst nicht ganz sattelfest im Englischen zu sein und welche andere praktikable Kommunikationsmöglichkeit gibt es auch auf internationalem Parkett? Schade, das Ganze stellt aufgrund der o.g. Faktoren keine wirklich kritisch niveauvolle Auseinanderstetzung dar, sondern bleibt häufig Fassade und irgendwie eben „nett“.
Wissenschaft als grosses und kleines Theater – hier haben wir wieder ein Paradebeispiel – vielleicht täte diesem Theater eine „Verfremdung“ und damit Kritik im Sinne von Brecht manchmal ganz gut.
Tags: Internationalität, Konferenz, Kongress
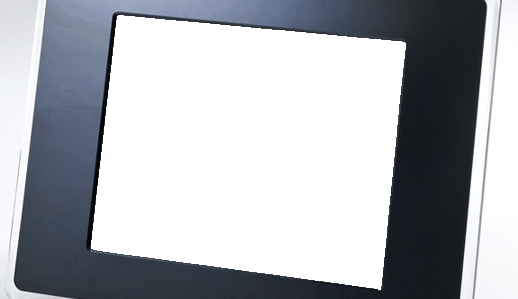

25. September 2008 um 11:22
Wenn die deutschen Hochschulen sich endlich darauf einstellen könnten, dass Wissenschaft nicht lediglich in Deutschland, sondern global abläuft und die Deutschen Wissenschaftlicher sich entsprechend orientieren würden, dann dürften die Sprachbarrieren eigentlich kein Hindernis an Kommunikation darstellen. Leider ist ein Großteil der deutschen Wissenschaft immer noch nicht an diesen Punkt gekommen und bei der Frage nach Referenzen wird man gebeten, diese selbst zu schreiben – man sei des Englischen nicht mächtig…
25. September 2008 um 11:36
Unbestritten? Kongressreisen sind anstrengend, Vorträge sind ermüdend und es bleibt im Allgemeinen kaum Zeit für Sightseeing.
Zur Sprache: Deutsche haben es unwahrscheinlich einfach, da Deutsch und Englisch so nah verwandt sind und Englisch eine recht einfache Sprache ist. Zudem waren es gerade deutsche Gelehrte, die in der Vergangenheit auf Latein und Griechisch Wert gelegt haben.
Englisch ist unvermeidlich. Wenn deutsche Wissenschaftler damit Schwierigkeiten haben, dann sollten sie ihre Englischkenntnisse verbessern.
Letzlich, zum Zweck von Kongressen: wer soll denn die Synthese machen? Und warum? Kongresse sind dazu da, Ergebnisse effizient zu kommunizieren und darüber zu sprechen. Es ist nich Aufgabe der Organisatoren Kongresse in eine universitäre Lehrveranstaltung umzuwandeln.
25. September 2008 um 12:12
Es braucht hier keine Kritik. Jeder Wissenschaftler kennt das Problem. Von daher auch die Koexistenz von kleinen Workshops mit deutlichem Schwerpunkt und grossen Kongressen, die eher in die Breite gehen (und eben bisweilen zu sehr in die Tiefe und dann unzusammenhaengend erscheinen). Wenn schon Kritik, dann gerne konstruktiv. Also nicht bloss benennen oder anklagen, sondern Alternativen oder klare Verbesserungsvorschlaege machen.
25. September 2008 um 12:52
Mangelnde Sprachkenntnisse sind nicht nur in Deutschland ein Problem. Im Sinne einer sprachlichen Vielfalt sollte man von jedem Wissenschaftler – auch aus den USA und Großbritannien – fließendes Beherrschen mindestens einer und gute Kenntnisse einer weiteren Fremdsprache erwarten. Sprachenlernen darf keine Einbahnstraße sein. Auch etwas Latein und Griechisch schadet niemandem, der wissenschaftlich arbeiten will. Denn jede Sprache hat ihren eigenen Wert und ihre Vorteile, um sich genau und in die Tiefe gehend auszudrücken, auch auf wissenschaftlichem Niveau. Darum: Kongresse in Deutschland mindestens zweisprachig, davon eine Kongressprache Deutsch (und in anderen Ländern mit ihrer Landessprache entsprechend).
25. September 2008 um 13:24
Ein wesentlicher Aspekt, der in der letzten Zeit bei Tagungen leider verstärkt zu beobachten ist, ist der reine Profit gepaart mit Profilierung der dahinter stehenden Organisation.
Nur die möglichst hohe Anzahl von teils gepfefferten Registrationsgebühren, nicht die Qualität und schon gar nicht eine Abstimmung von wissenschaftlichen Präsentationen aufeinander spielt hier eine Rolle. Allgemein sind in Fachkreisen solche dubiosen Großkongresse bekannt, aber vielleicht ist der enttäuschte Wissenschaftler ja nichts ahnend auf eine solche Veranstaltung geraten…. ?
25. September 2008 um 13:32
Zum Sprachaspekt: Zwar ist Englisch seit langem Quasi-Standard für die Kommunikation auf Fachtagungen. Zu bemerken wäre leise, daß nicht wenige der vorbildlich „globalisierten“ (jungen) deutschen Wissenschaftler in erschreckend ansteigender Tendenz selbst kaum noch grammatikalisch korrekt in ihrer eigenen Muttersprache zusammenhängend kommunizieren oder schreiben können. Was heutzutage zum Teil an Masterarbeiten oder Vorträgen auf Deutsch innerhalb der Universität abgeliefert wird ist in dieser Hinsicht erstaunlich…..
25. September 2008 um 14:24
man sollte nicht den fehler machen, von kongressen etwas zu erwarten, wofuer sie nicht gedacht: weder fuer uni-seminare noch fuer durchmoderierte infotainment-shows.
wissenschaftliche kongresse bieten plattformen fuer mehr oder weniger gelingende kleine sitzungen, in denen oft doch recht konkrete fragen behandelt werden (je nachdem wie gut die teilnehmenden sind).
des weiteren sind kongresse dazu da, auf die in verschiedenste richtungen existenz eines faches, einer disziplin, scientific community o.ae. aufmerksam zu machen. zugleich wird denjenigen, die sich bei dieser gelegenheit zusammenfinden, die existenz ihrer community selbst deutlich.
kongresse, realistisch verstanden und gebraucht, sind sehr wohl gelegenheiten hochgradig funktionalen arbeitens. networking ist nur ein teilaspekt dieser manifestationen und legitimationen professioneller daseinsberechtigung.
wer an kongressen besonders das kulturprogramm schaetzt oder im wirrwarr der angebote ertrinkt, ist entweder in der wissenschaft als profession noch nicht angekommen, hat sich schon wieder verabschiedet oder aus einem anderen grund keine selektionkriterien fuer die knappe ressource aufmerksamkeit zur hand.
nur mut, das kommt noch, wenn man es weiter versucht!
25. September 2008 um 17:48
Was vorgetragen wird, kann man, wenn’s gut ist, früher oder später auch nachlesen. Im Grunde werden die Vorträge ja auch bloß gehalten, weil man sonst keine Reisekosten abrechnen kann. Vorschlag: Kongresse ganz ohne Vorträge, bloß mit informellen Gesprächen in größerer oder kleinerer Runde bei Käse und Wein. Das wär’s!
25. September 2008 um 18:48
gruß an den soziologen, der offenbar in seiner profession angekommen ist. möglicherweise geht mit dem „ankommen in der profession“ gleichzeitig auch einher, dass man nicht mehr bemerkt, welcher unsinn gelegentlich stattfindet, oder die folgen dieses unsinns übersieht.
so wäre es m.e. wünschenswert, beim „ankommen in der profession“ eine unterstützung zu bekommen, die über die ermunterung „dann geh doch häufiger zu solchen kongressen, du wirst dich irgendwann daran gewöhnen, und noch später wirst du anfangen, es gut zu finden, und ganz viel später wirst du überzeugt sein, dass keine andere art der kongressgestaltung überhaupt nur denkbar ist – dann bist du angekommen!“ hinausgeht. so eine ermunterung könnten gerade diese kongresse sein, einladung und inspiration – ich nehme aber eher eine abstoßende wirkung wahr. ausladend, desinspirierend.
ebenso wünschenswert wäre es, auch auf kongressen erkennbare und explizit benannte ziele zu haben und diese sowohl in der struktur als auch im ablauf umgesetzt zu sehen, oder ihnen zumindest eine chance zur umsetzung gegeben wissen. dafür ist nicht nur die „qualität“ der teilnehmenden entscheidend, sondern auch und gerade das gewählte format. die monierten 15-minuten-vorträge, 4-6 stück im bündel, haben nach meinem eindruck nur noch den selbstzweck, dass es stattgefunden hat. radikal gesprochen, gehören sie verboten oder sonstwie abgeschafft.
egal ob „in der profession angekommen“ oder nicht – so ein unsinn muss nicht sein, und es geht besser. nicht jeder mist muss durch das siegel „das gehört zu unserer profession“ geadelt werden, ebensowenig wie jeder unsinn durch den autor „stammt von einem professor“ an qualität gewinnt.
nur mut, der wandel kommt noch, wenn wir es weiter versuchen!
25. September 2008 um 19:50
Konstruktiver Vorschlag zum Umgang mit den Kurzpräsentationen: Meine Erfahrung ist, dass die Panels stark an Qualität gewinnen, wenn man nicht den Konferenzorganisator das Panel zusammenstellen lässt, sondern gleich ein ganzes Panel einreicht. Das ist natürlich auch nicht ganz unproblematisch (v.a. wenn dann jemand einfach seine „Buddies“ einlädt), aber zumindest kann man ein klares Thema setzen und durch die Wahl von Präsentatoren, Discussant(s) und Chair die Qualität und Kohärenz erhöhen.
Zum „an die Hand nehmen:“ Bei uns zumindest gibt es bei großen Kongressen meist explizite Veranstaltungen für den Nachwuchs, wo über Sachen wie Publikationsstrategien gesprochen wird etc. Abgesehen davon finde ich dass die Einführung in die Scientific Community geteilte Verantwortung des Einzelnen (hingehen, Mund aufmachen, Leute ansprechen!) und des Betreuers ist (den Nachwuchs Tips geben und den relevanten Leuten vorstellen).
Für mich waren und sind wissenschaftliche Kongresse eine der wichtigsten Quellen von Motivation und Input für meine Arbeit, und noch dazu machen sie Spaß.
26. September 2008 um 11:07
Wissenschaftliche Kongresse kenne ich vor allem vom Blickwinkel der Organisation. Hunderte Einreichungen in sinnvolle panels zu verwandeln ist immer schwierig, nicht nur weil die Themen sehr divergent und die Abstracts, auf deren Grundlage entschieden wird, kurz sind, auch weil Präsentationen häufiger als gedacht kurzfristig abgesagt werden, ausfallen oder umgeplant werden müssen. Ein Konferenzprogramm ist erst fertig, wenn der Kongress vorbei ist.
Allerdings weiß ich auch, dass vieles auf Kongressen, vielleicht das wichtigste, zwischen den Panels passiert. Die Nachfragen in den Pausen, Austauschen von Kontakten, Hinweis auf spannende Kollegen, die zu ähnlichen Feldern arbeiten. Nicht alles ist für alle spannenden und kann es auch gar nicht sein.
Auf Kongressen treffen Kollegen mit unterschiedlichen Forschungs-traditionen, unterschiedlicher internationaler Erfahrung und letztlich auch unterschiedlicher Kongresserfahrung aufeinander. Für einige mag dies eine Qualitätsminderung darstellen, andere nehmen aus der vielleicht ersten größeren internationalen Erfahrung neben zahlreichen Eindrücken auch Erkenntnisse mit, wie sie sich das nächste Mal vielleicht besser präsentieren können.
26. September 2008 um 21:48
Ein Kongress hat für mich den Sinn von Zusammenkommen und Austausch. Beides sollte motivieren und Spaß machen. Dass dies oft nicht mehr der Fall ist, liegt m.E. an der Organisation solcher „Events“.
Jede/r Teilnehmende möchte sich doch soviel wie möglich einbringen; so „richtig“ zum Zug kommen aber meist nur die „auserkorenen“ Vortragenden. Da dieses Dilemma schon länger gesehen wurde, ist man dazu übergegangen, so „nebenbei“ auch noch Workshops anzubieten, damit „die Anderen“ auch mal zum Zug kommen.
Natürlich ist das auf die Dauer unbefriedigend für die Teilnehmer/innen.
Ich habe mittlerweile die besten Erfahrungen mit Kongressen gemacht, deren Organisatoren sich trauen, alle (bekannte und weniger bekannte Wissenschaftler/ Autoritäten) einzuladen, und das Thema offen für eigene Gestaltung und Visionen lassen; dann passiert nämlich das, was sich viele Teilnehmende wünschen: Jeder diskutiert mit jedem, jeder kann sein eigenes Expertentum einbringen und es eröffnen sich plötzlich für alle ganz neue Perspektiven. Diese Energie aufnehmend dann mit einer Handlungsplanung/ weiteren Aktivitäten zu kombinieren, bringt den Wunsch vieler zum Tragen, dass nämlich die Zeit auf einem Kongress nicht vollständig „umsonst“ war, sondern auch konkrete Aktivitäten daraus hervorgehen können.
Die Methode, die dahinter steckt, heißt „Open Space“ und ist eine seit den 80-ger Jahren praktizierte Form der Moderation von Großgruppen. Nun aber nicht abschrecken lassen: Open Space erfährt sich so ähnlich wie es in einem der Kommentare hieß: „Kongresse ganz ohne Vorträge, bloß mit informellen Gesprächen in größerer oder kleinerer Runde bei Käse und Wein. Das wär’s!“ – Es ist eine Art große Kaffeepause, in der man in regem Austausch steht, und dabei gar nicht merkt, wie sehr man tatsächlich arbeitet.
Für mich gibt es keine bessere und befriedigendere Art des Zusammenkommens und Austausches und ich plädiere dafür, dass sich auch die Wissenschaft den modernen Methoden der Kommunikation öffnet!
Übrigens funktioniert Open Space auch in mehreren Sprachen gleichzeitig. Und alle Teilnehmer/innen sind begeistert, weil man/frau auch von anderen Weltsprachen profitieren kann!
1. Oktober 2008 um 12:04
ja, davon träume ich auch, dass kongresse – wenn denn doch das beste in den pausen passiert – gezielt so gestaltet werden, dass in den pausen die leute auch tatsächlich zusammenkommen (oder wann auch immer) und dass die grenzen zwischen ingroup und outgroup, zwischen „ach sie sind nachwuchs, wie süß“ und „wir sind hier die professoren“ aufgeweicht werden.
da habe ich schon diverse versuche mitbekommen, die meisten (aber nicht alle!!!) davon halbherzig bemühte rohrkrepierer, wo die organisatoren zuviel angst vor echter innovation hatten – und wünsche mir kongresse, die ganz absichtlich zumindest an einem ausgewählten tag es innovativ, kommunikativ und anders machen. wer dann da nicht kommt, kommt eben nicht und bleibt in seiner vergangenheit stecken.
deutsche kongresse sind bislang im durchschnitt weder ermutigend noch kommunikationsfördernd – also rafft euren mut zusammen und wagt den schritt ins neuland, experimentiert und probiert. ganz von allein wird das deutsche wissenschaftssystem nicht gesunden, und kongresse sind eine der gelegenheiten, medizinisch wirksam zu werden.
1. Oktober 2008 um 12:49
Jeder Wissenschaftler sollte fließend Englisch beherrschen. Ich sehe nicht, wie, bis auf Spezialgebiete, der Gebrauch zusätzlicher Sprachen dem wissenschaftlichen Austausch in irgendeiner Form dienlich sein würde.
1. Oktober 2008 um 16:02
Ein eher ueberfluessiger Beitrag. Jeder Wissenschafter kennt die Problematik, und die Kunst besteht natuerlich auch darin, die richtige Tagung auszuwaehlen, die den eigenen Interessen entspricht. Grosse Tagungen wie die beschriebene sind typischerweise einr Ansammlung kleinerer Interessengruppen, daher auch die Parallelitaet der Veranstaltungen.
Englisch ist die Wissenschaftssprache dieses Planeten, und deutsche Wissenschaftler haben wesentlich weniger Ausreden dafuer, ihr Englisch „verhandlungsfaehig“ zu machen, als z.B. die Kollegen aus China und Korea, die hier oft Erstaunliches leisten.
Also: Erfahrung sammeln, nicht klagen.